Einleitung
In den letzten Jahren hat sich Europas digitale Landschaft rasant gewandelt. Cloud-Technologien, Datenräume und Künstliche Intelligenz (KI) sind heute die zentralen Säulen digitaler Wertschöpfung. Doch trotz starker Forschungslandschaften und industrieller Exzellenz hinken Österreich, der DACH-Raum und die EU insgesamt hinter den globalen Tech-Führern her. Die entscheidende Frage lautet: Was brauchen wir, um souveräne, innovationsfähige digitale Infrastrukturen aufzubauen?
1. Ausgangslage: Fragmentierung statt Vernetzung
Während globale Hyperscaler den Cloud-Markt dominieren, kämpft Europa noch immer um digitale Souveränität. Viele kritische Infrastrukturen liegen außerhalb europäischer Rechtsräume. Unternehmen zögern bei der Cloud-Einführung aufgrund regulatorischer Unsicherheit, Sicherheitsbedenken und Abhängigkeiten.
Auch Daten sind oft schwer zugänglich. Sektorübergreifende oder grenzüberschreitende Datenkooperationen sind noch selten. KI-Anwendungen basieren häufig auf nicht-europäischen Datensätzen – europäische KI-Startups stoßen an Wachstumsgrenzen.
2. Cloud-Infrastruktur: Lokal bauen, offen denken
Eine starke digitale Wirtschaft braucht skalierbare, vertrauenswürdige Cloud-Infrastrukturen. Das heißt nicht, alles selbst zu machen – sondern europäisch zu denken: mit offenen Standards, interoperablen Architekturen und föderierten Modellen wie GAIA-X.
Was es braucht:
- Branchenspezifische Cloud-Angebote (z. B. Gesundheit, Industrie, Verwaltung)
- Öffentliche Ausschreibungen, die vertrauenswürdige Anbieter fördern
- Harmonisierte IT-Sicherheits- und Datenschutzstandards
- EU-weite Zertifizierungen und Compliance-Mechanismen
Österreich kann hier als Vorreiter dienen – als Innovationsraum für europäische Cloud-Lösungen.
3. Datenräume: Vom Silodenken zur Kooperation
Daten sind nicht das neue Öl – sie sind der neue Boden. Nur wenn wir Daten vernetzen und analysieren, entsteht echter Mehrwert. Europäische Datenräume sind daher der Schlüssel. Initiativen wie der European Health Data Space oder Catena-X müssen rascher skaliert werden.
Dafür nötig sind:
- Governance-Modelle, die Vertrauen schaffen (Nutzungskontrolle, Datensouveränität)
- Sichere Plattformen für Datenaustausch
- Anreize für Unternehmen, nicht-sensible Daten zu teilen
Öffentliche Stellen sollten mit gutem Beispiel vorangehen – als Datengeber und Daten-Treuhänder.
4. Künstliche Intelligenz: Vertrauensvoll und skalierbar
Europas KI-Strategie betont Ethik und Verantwortung – zu Recht. Aber Regulierung allein reicht nicht. Der AI Act setzt einen wichtigen Rahmen, muss aber praxisnah und innovationsfördernd umgesetzt werden.
Herausforderungen:
- Zugang zu hochwertigen, domänenspezifischen Daten
- Rechenkapazitäten (GPUs) für das Training großer Modelle
- KI-Kompetenz in Verwaltung und KMU
- Internationale Standards vs. europäische Werte
Österreich kann hier als Testmarkt für vertrauenswürdige KI dienen – in Gesundheit, Mobilität, Verwaltung.
5. Politik & Governance: Skalierung ermöglichen
Digitale Souveränität heißt nicht Abschottung – sondern aktive Gestaltungsfähigkeit. Öffentliche Hand, Forschung und Wirtschaft müssen koordiniert zusammenarbeiten.
Nötig sind:
- Smarte, risikobasierte Regulierung
- Offene Plattformen statt isolierter Datensilos
- Förderung interoperabler, skalierbarer Lösungen
- Innovationsförderung für KMU und Deep Tech
Fazit: Jetzt handeln – gemeinsam
Die digitale Zukunft Europas ist kein Selbstläufer. Aber sie ist machbar. Österreich und die DACH-Region haben alle Voraussetzungen: Know-how, Infrastruktur, Werte.
Aber um nicht nur mitzuhalten, sondern voranzugehen, müssen wir:
- In europäische Cloud-Infrastruktur investieren
- Datenräume aktiv gestalten
- Vertrauenswürdige KI skalieren
- Ermöglichende Rahmenbedingungen schaffen
Jetzt ist die Zeit, Europas digitale Grundlage zu bauen – gemeinsam und entschlossen.
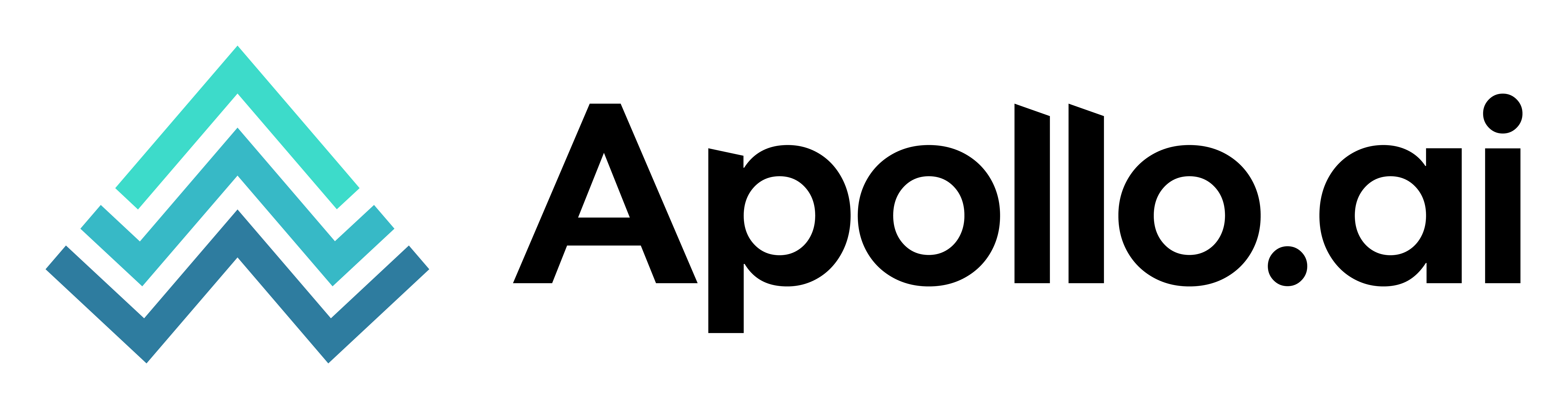
.avif)


